Literatuur Zonder Leeftijd. Jaargang 19
(2005)– [tijdschrift] Literatuur zonder leeftijd–
[pagina 64]
| |||||||||||
Medienkinder, Kindermedien - Herausforderung für den Deutschunterricht
| |||||||||||
[pagina 65]
| |||||||||||
sie im Folgenden heranziehe, sind keinesfalls misszuverstehen als ‘Abbildungen’ sozialisatorischer Wirklichkeit. Medien bilden nichts ab. Sie konstruieren etwas, und um die Konstruktionen geht es. Mit ihrer Hilfe beteiligen sich heute Bücher und Filme für Heranwachsende an einem Diskurs, der seit der Aufklärung beständig ‘Kindheit’ redefiniert, und seit der Romantik auch ‘Jugend’. Franz-Josef Röll (2001) hat eine symbolorientierte Medienpädagogik vorgeschlagen, die den von auf Medieninhalten und -formaten modulierten Denkbildern nachgeht; dazu möchte ich im Hinblick Kinder- und Jugendmedien einen Beitrag leisten. | |||||||||||
1. Mediensozialisation als Thema neuerer Kinder- und JugendmedienDarf ich Ihnen Jonas vorstellen? Er ist etwa 13 und oft allein, weil seine Eltern viel verreist sind. Geschwister hat er nicht. Man sieht ihn oft mit einem Camcorder herumlaufen, dann arbeitet er an seinem Videotagebuch, das sich seine Eltern später ansehen können. Er ist auch viel im Internet zugange. Im Gefrierschrank hat er 50 abgepackte Flugzeugmenüs, wozu er schon mal seine Freundin Ida einlädt, die sich doch endlich für ihn entscheiden soll. Wir haben übrigens den Verdacht, dass er die Menüs direkt beim Caterer im Internet bestellt, zu Lasten eines gewissen Jung Sing von Singapur Airlines. Jedenfalls verfügt er über dessen persönliche Daten. 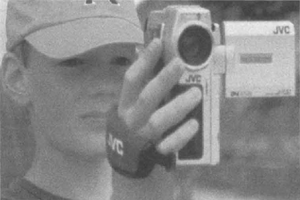 Jonas in Kletter-Ida.
Insgesamt könnte man, wenn man einen Beleg für Michael Charltons (1996) These von der Nutzung der Medien zur Lebensbewältigung sucht, ein besseres Beispiel kaum finden - obwohl es Jonas so nicht gibt. Er ist eine Figur aus dem skandinavischen Kinderfilm Kletter-Ida, auf den ich später noch eingehe. Dass hier fiktionale Beispiele untersucht werden, die keine Wirklichkeit abbilden, habe ich schon betont. Das heißt aber nicht, dass sie zur Wirklichkeit nicht in Beziehung stünden. Sie versanken sich den Kindheitsbildern erwachsener Medienmachern, und sie wirken auf die Kindheitsbilder der Rezipienten, d.h. auch auf die Selbstbilder der Heranwachsenden zurück. Daher ist ihre Interpretation lohnend; Deutsch-Lehrenden schlage ich sie vor, weil an ihnen wertungsabstinentes Beschreiben von Mediennutzung zu schulen ist. | |||||||||||
[pagina 66]
| |||||||||||
Ein zweites Beispiel entnehme ich einem weiteren Kinderfilm: Katja und der Falke. Die etwa 11jährige Katja hat berufstätige Eltern und ist ebenfalls Einzelkind. Sie wohnt am Rand einer dänischen Stadt und ist gern im Wald, wo sie eines Tages während eines starken Gewitters einen jungen Falken vor dem Absturz aus seinem Nest rettet. Was sie über Vögel alles weiß, stammt aber nicht nur aus dem Wald. Es stammt aus den Medien, wie die Eröffnungssequenz des Films zeigt: Katja kommt aus dem Wald. Bevor sie die Straße überquert, setzt sie Kopfhörer auf und hört Vogelstimmen vom Walkman, die sie beim Gehen imitiert. Zuhause entnimmt sie einem von der Mutter an den Kühlschrank geklebten Zettel, welches Fertiggericht sie sich auftauen soll, bereitet ihr Mittagessen und trägt das Tablett ins Wohnzimmer, wo sie während des Essens den Laptop aufklappt und in einem digitalen Kinderlexikon Informationen über den Falken nachliest. Die Sequenz endet damit, dass draußen im Garten Nachbarskinder so viel Lärm machen, dass Katja sie vertreibt, obwohl sie behaupten Katjas Eltern hätten ihnen das Spielen im Garten erlaubt. Eine Einladung zum mitspielen schlägt sie aus. Nun sind zwar gängige Annahmen über durch Mediensozialisation radikal veränderte Kindheitsmuster noch empirisch zu prüfenGa naar voetnoot1., gewinnen aber eine gewisse Plausibilität nicht zuletzt auf der Basis einer Analyse der Kindermedien selbst: Kinderfilme seit den 90er Jahren, etwa Katja und der Falke, Kletter-Ida, Pünktchen und Anton (Link 1998) oder Jugendfilme wie Nach fünf im Urwald zeigen Heranwachsende ganz selbstverständlich dabei, zur Lebensbewältigung auch moderne Medien zu nutzen. Fiktionale Literatur präsentiert allerdings modellhaft verdichtete Fälle, die gelegentlich extrem anmuten mögen. Aber ihr Sinn ist - wie gesagt - ja auch nicht Mimesis, sondern Bereitstellung von Denkbildern, die kulturelle Entwicklungen diskurszugänglich machen. Ein Beispiel ist Hans-Christian Schmids Jugendfilm Nach fünf im Urwald (mit Franka Potente in ihrer ersten Rolle). Die Handlung dieses Films ist kurz zu rekapitulieren. Anna (Franka Potente) hat in Abwesenheit der Eltern eine Party gefeiert, die außer Kontrolle geriet: Ihr völlig unbekannte Jugendliche mischten sich unter die Gäste, respektierten keine off-limits-Zonen und verwüsteten das Wohnzimmer, wobei auch eine der seltenen Schallplatten aus des Vaters Sammlung zu Bruch ging. Daraufhin bekommt Anna Hausarrest, und wollte doch zu einem Casting nach München fahren, an dem sie unbedingt teilnehmen wollte, mit einem Song von Janis Joplin (Oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz). Medien - und damit liegt dieses Filmbeispiel, wie originell es als Jugendfilm auch ist, durchaus im mainstream - werden hier gezeigt als integraler Bestand- | |||||||||||
[pagina 67]
| |||||||||||
teil der Lebenspraxis: was dem Vater, einem ambitionierten Lokalpolitiker, seine Jazz-Plattensammlung, ist der Tochter Janis Joplin und das Fernsehen, in das sie unbedingt kommen will. Medien tragen hier offensichtlich zu dem bei, was Wicklund/Gollwitzer (1982) als ‘symbolic selfcompletion’ bezeichnet haben. Identitätsbildung ist das hier angeschlagene Thema. Selbstverständlich ist dieses Thema in der KJL nicht neu und schon gar nicht originell; neu aber ist die Wucht, mit der die Medien auf Identitätsbildung Einfluss nehmen bzw. in deren Sinn und Interesse instrumentalisiert werden. Was Tilmann Habermas (1996) ‘geliebte Objekte’ genannt und in der Lebenspraxis (junger) Erwachsener aufgesucht hat, wird sich künftig - so meine Vermutung - stark verschieben: weg von den ‘nichtvirtuellen’ Objekten (Spielzeuge usw.), hin zu den medialen: Filme, PCSpielfiguren, Hörbücher, Filmstars und Popgrößen (vgl. in Bezug auf Grundschulkinder z.B. Mattern 1999). Sie werden es sein, die in Zukunft verstärkt als Symbole und Instrumente der Identitätsbildung (Untertitel bei Habermas) fungieren. Wenn ich sage, solche Filme zeigen vor allem Heranwachsende ganz selbstverständlich dabei, zur Lösung ihrer Probleme auch moderne Medien zu nutzen, so ist das allerdings nur die eine Seite der Medaille. Wie das letzte Beispiel ebenfalls zeigt, sind damit auch Diagnosen von Abhängigkeit verbunden: ‘Selfcompletion’ ohne den Auftritt beim (angeblichen) Casting kann sich die Heldin nicht vorstellen, deshalb muss sie natürlich heimlich doch nach München fahren. Abhängigkeit von der Medialität der Welt, in der sie leben, ist den Kindern und Jugendlichen keine bewusste oder reflektiert verarbeitete, aber eine mitlaufende Erfahrung. Um das ins Bewusstsein zu heben, braucht es dann einen guten Jugendfilm, der in einer an das für Anna frustrierende Casting anschließenden Sequenz auf dem Männerklo zwei pinkelnde Zyniker vorführt, die sich über die Opfer mokieren. Der Kinderroman befasst sich deutlich weniger mit Fragen der Mediensozialisation als der Film. Schweikart (1995, 113) vermutet, das liege am Durchschnittsalter der augenblicklich erfolgreichen Autorengeneration, die selbst noch nicht AV-sozialisiert sei. Eine an der Universität Würzburg eingereichte Arbeit über Kindheitsdarstellungen in für den Deutschen Jugendliteraturpreis nominierten Titeln der Jahre 2000-2004 (Plohncke 2005, 137f.) widerlegt das: Die Geburtenjahrgänge reichen von 1940 bis 1965. Und tatsächlich gibt es einen Mediendiskurs auch in der Kinderbuchliteratur. Er oszilliert zwischen emphatischer Betonung der ‘alten’ Kulturtechnik Lesen und satirischer Überspitzung ‘neuer’ Medienkompetenz. Für das erste ist Funkes ‘Tintenherz’ ein schlagendes Beispiel, für das zweite Colfers ‘Artemis Fowl’. | |||||||||||
[pagina 68]
| |||||||||||
‘Schmeck jedes Wort, Meggie, flüsterte Mos Stimme in ihr, lass es dir auf der Zunge zergehen. Schmeckst du die Farben? Schmeckst du den Wind und die Nacht? Die Angst und die Freude? Und die Liebe. Schmeck sie, Meggie, und alles erwacht zum Leben.’ ‘Lesekompetenz’, ein Hochwertbegriff um die Wende zum 21. Jahrhundert, wird hier - fast möchte man sagen: provokativ - gegen das reading literacy-Konzept der internationalen Studien (PISA, IGLU) als Fähigkeit der Verlebendigung, als Öffnung des geschaffenen Vorstellungsraums aufgefasst. Meggies Vater Mo verfügt über diese ‘Lesekompetenz’, die durchaus nicht harmlos ist: Er hat damit unbeabsichtigt Gangster aus einem Abenteuerroman freigesetzt, die jetzt nach ihm und ‘ihrem’ Buch suchen. Für jede freigesetzte Figur wird außerdem ein wirklicher Mensch in das Buch hineingezogen (darunter Meggies Mutter). Auch der zwölfjährige Artemis bei Colfer verfügt über gefährliche Kompetenzen: Er kennt sich in jeder Art digitaler Technologie aus, hat sich Kenntnisse über die Welt der Unterdirischen (Feen, Elfen, Kobolde usw.) verschafft, die sonst kein Mensch besitzt - z.B., dass jede(r) Unterirdische ein persönliches ‘Buch’ verwahrt, gleichsam als kulturelles Gedächtnis und Vorrat an magischem Wissen. Unterstützt von seinem hervorragend ausgebildeten Leibwächter (‘Butler’), kann Artemis einer versoffenen Fee, die sich schlecht wehren kann, ihr Buch entwenden, um es einzuscannen. Aber wie es lesbar machen? ‘Wie sich herausstellte, war das Buch wesentlich widerspenstiger, als Artemis gedacht hatte. Es schien sich beinahe willentlich gegen ihn zu sträuben. Welches Programm er auch darüber laufen ließ, der Bildschirm blieb leer. (..) Er nahm jedes einzelne Schriftzeichen und ließ es mit englischen, chinesischen, griechischen, arabischen und kyrillischen Texten vergleichen, ja sogar mit Ogham. Nichts.’ Natürlich schafft Artemis es doch, indem er sein ‘PowerBook’ dazu bringt, die Ähnlichkeit zwischen den Schriftzeichen des magischen Buches und den Hieroglyphen aus der Grabkammer Tut-ench-Amuns zu erkennen und auszuwerten. (vgl. ebd., 27 f.). | |||||||||||
2. Metamediale Diskurse I: Kindermedien, die Stellung beziehen zur Mediatisierung von KindheitEine weitere Möglichkeit, die die Printliteratur erprobt, ist die (selbst-)ironische Thematisierung von Sozialisationsvoraussetzungen der eigenen Leserschaft: | |||||||||||
[pagina 69]
| |||||||||||
‘Ich unterbreche das laufende Programm an dieser Stelle nur ungern, aber es muss sein’. Ihr kennt das ja vom Fernsehen. Von den Werbeblöcken zwischen Zeichentrickserien, in denen japanische Kinder ständig aufgeregt herumschreien und mir ihren großen Kulleraugen klimpern. Hat euch eigentlich schon mal jemand gesagt, dass es im Fernsehen um nichts anderes als ebendiese Werbeblöcke geht? Glaubt ihr mir vielleicht nicht, ist aber so. Hier ist der unwiderlegbare Beweis: was tut ihr, sobald der Abspann einer solchen Sendung läuft? Geht ihr zu euren Eltern und sagt, liebe Mutter, lieber Vater, soeben habe ich diesen sehr lehrreichen Film gesehen, in dem ein paar kleine Superhelden mit irgendeiner Augenkrankheit sich mehrfach krankenhausreif geprügelt haben? Nein, ihr rennt zu euren Eltern und ihr schreit: ‘Hey, Mama, Papa, es gibt da dieses tolle Plastikpferd, das Haufen in drei verschiedenen Geschmacksrichtungen kackt, wenn ich es am Schwanz ziehe!’ Was auf den ersten Blick als etwas krude Stellungnahme zur Mediensozialisation daher kommt und an Kästners ‘Nachdenkereien’ erinnert, weil es scheinbar junge Leserlnnen belehrt, erweist sich, liest man Steinhöfels fantastischen Kinderroman ganz, als doppelbödig: Der Erzähler, der immer wieder sein Publikum adressiert, ist ein Griesgram, dessen pädagogische Kompetenz sehr in Frage steht. Solche direkten Bezugnahmen auf Medien sind aber, auch als doppelbödige, die Ausnahme. Wichtiger sind implizite Bezugnahmen. Ein gutes Beispiel findet sich in Caroline Links Remake von Pünktchen und Anton: Das Mädchen, allein in ihrem Zimmer der elterlichen Villa, sieht sich einen Videobrief an, den die als Repräsentantin einer karitativen Organisation Afrika bereisende Mutter ihr geschickt hat. Sie schaut sich die vielen schwarzen Kinder an, die ‘es nicht so gut haben wie du’, und drückt die Still-Taste der Fernbedienung, als das Gesicht der Mutter in Großaufnahme ins Bild kommt. Dann steht sie auf, tritt nahe vor das Gerät und streichelt den Bildschirm: ‘Ach, Mami...’ Die Erwachsenen, die solche Bilder inszenieren, mögen von einer Entfremdungs- oder Deprivationsdiagnose ausgehen. Wie kindliche Zuschauer das sehen, ist eine andere Frage. Bei Jonas in Kletter-Ida werden sie eher das Spiel mit den Möglichkeiten des Internets wahrnehmen und daher den Helden als erfolgreich Handelnden. Pünktchen wird anders eingeführt - leidender, sozusagen. Auch hier ist Video das Kontaktmedium zur abwesenden Bezugsperson. | |||||||||||
[pagina 70]
| |||||||||||
Auch für Pünktchen, wie für Jonas, sind technische Medien wie Videobriefe nichts Besonderes. Die Abwesenheit der Mutter ist - oder scheint - es leider auch. Das entspricht, auch wenn die meisten abwesenden Eltern nicht in Afrika sind, durchaus einer psychosozialen Realität. Es wäre trotzdem nicht richtig zu sagen, dass solche Medienprodukte die Tatsache der Mediensozialisation im späten 20. Jahrhundert ‘abbilden’ oder ‘wiedergeben’ würden. Beschränkt man sich nicht gerade auf problematische Produkte wie die Pseudo-SF-Romane des Andreas Schlüter, so stellt sich vielmehr schnell heraus, dass in aller Regel ein metamedialer Diskurs vorliegt. Damit meine ich, dass solche Bücher und Filme sich nicht damit begnügen, die doch wohlbekannten Umstände medialer Sozialisation gleichsam an die Zuschauer zurückzuspielen (die eben selbst mit Medienrezeption befasst sind): Neuere Kinder- und Jugendmedien behandeln nicht nur Medienkindheiten als Motiv und Thema, sondern greifen in den Medien(kindheits)diskurs unserer Kultur auch ein, indem sie zur Medialität von Kindheit Stellung beziehen: Was geschieht denn in dieser Sequenz von Caroline Links Kinderfilm? AV-Medien, scheinbar durchaus kreativ und sozial geschickt zur Lebensbewältigung eingesetzt (die karitativ die 3. Welt bereisende Mutter hat einen Videobrief aus Afrika geschickt), erweisen sich als Bumerang: Das anwesende Bild, von Pünktchen erzeugt, macht die Abwesenheit der Mutter, die Bezugsperson für so viele fremde Kinder ist, so deutlich, wie kein Brief oder Anruf es könnte. Das ist keine Pfeife, schrieb Magritte unter sein berühmtes Bild einer Pfeife. Das ist keine Mutter. Es ist nur Video. Damit findet die kurze Sequenz ein hochaufgeladenes Bild - gestreichelt wird der Bildschirm, nicht die Mutter - für das Problem Pünktchens, das zwar nicht - wie Freund Anton - materielle Not leidet, sondern seelische. Film ist ja schön, aber als ästhetische Erfahrung und nicht als Ersatz. Das Bild wirkt weit über die fiktionale Situation hinaus: Nicht das Medium ist das Problem, sondern die soziale Situation, in der es Unersetzliches ersetzen soll.Ga naar voetnoot2. Weniger einfach ist die metamediale Stellungnahme in Kletter-Ida. Die Art, wie dieser Film sich in den Diskurs über Kinder und Medien einmischt, ist sozusagen bösartiger. Jonas ernährt sich buchstäblich von den Medien. Die Eltern scheinen ihm viel weniger zu fehlen als Pünktchen. Sie schicken ihm Pokemon-Spiele und haben keine Ahnung, dass ihr Sohn sich zum Hacker entwickelt. Dass er die bewunderte Ida immer wieder filmt, hat eine harmlose Seite und eine abgründige: Auch Stalker-Karrieren beginnen so. Im Übrigen ist die schon angedeutete Internetkriminalität spätestens dann kein Kinderkram mehr, als Jonas | |||||||||||
[pagina 71]
| |||||||||||
einen von Ida geplanten Bankraub durch die Online-Bestellung von drei Profi-Funkgeräten für Singapur Airlines tätig unterstützt. Das in der Kinderliteratur bekannte und bereits mit Recht auch problematisierte Phänomen, dass Kinder sozusagen als bessere Menschen die Probleme der Erwachsenen zu lösen haben, findet nämlich auch hier Verwendung: Ida, Jonas und dessen Rivale Sebastian müssen die fehlenden Mitteln für die teure OP von Idas am Mount Evererst abgestürzten und durch Spätfolgen des Unfalls gelähmten Vater beschaffen, und zwar aus der Bank, in der die Mutter arbeitet. Sie tun das, indem sie virtuos auf der Klaviatur der Transport-, Überwachungs- und Computertechnik der aktuellen Jahrtausendwende spielen - z.B. ein unter dem Vorwand, sie drehten einen Kinderfilm, mit dem Boss vor dessen Haus produzierten Clip in das Netz einspeisen, das die Überwachungskameras mit dem Arbeitsplatz des Wachdienstes verbindet. So gewinnen sie die entscheidenden Minuten Vorsprung, die sie als Nachwuchs-Geldräuber brauchen:
 Ida und ihre Freunde geben vor, einen Kinderfilm mit dem Bank-Boss zu drehen (Kletter-Ida).
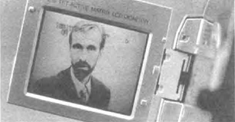 Die Einstellung, auf die es nachher ankommen wird, im Display des Camcorders (Kletter-Ida).
Abgesehen davon, dass die raffinierte Konstruktion trotz einiger Überzeugungskraft der filmischen Mittel und der beachtlichen schauspielerischen Leistungen sachlich nicht durchweg überzeugen kann, vermittelt der Film dem, der ihn ernst nimmt, sie auch eine bedenkliche Botschaft: Kinder, ihr kriegt eure Probleme nur dann gelöst, wenn ihr als Computerfreaks und Medientechniker topfit seid. In satirischer Überhöhung findet sich diese Denkfigur ja auch in den Artemis-Romanen des Eoin Colfer, dessen skurrile Einfälle aber die Trilogie weitgehend gegen das Missverständnis absichern, hier werde im Ernst solche Medienkompetenz 12jähriger oder Erwachsener behauptet. Der Gegenspieler des genialen Artemis auf der Unterweltseite, der schrullige Zentaur Foaly, ist eine herrliche Parodie auf die alleskönnenden Geheimdiensttechniker, von denen Agenten aller Art in einschlägigen Romanen und Filmen immer genau zu richtigen Zeitpunkt die abgefahrenste neue Technologie bekommen, mit der sie dem Feind um den entscheidenden Schritt voraus sind. | |||||||||||
[pagina 72]
| |||||||||||
3. Metamediale Diskurse I: Kindermedien, die sich selbst als Medien thematisierenIn Wolfgang Petersens Verfilmung der Unendlichen Geschichte gibt es eine Sequenz, in der der von Gleichaltrigen gehetzte Bastian Zuflucht in einem Antiquariat sucht. Schwer atmend von innen gegen die gerade geschlossene Tür gelehnt, hört er den Antiquar hinter seiner Zeitung raunzen: ‘Was willst du?’ Neben der Möglichkeit, in den Mediendiskurs unserer Kultur einzugreifen und indirekt Stellung zu beziehen, gibt es noch eine weitere: Jedes Medium kann sich selbst thematisieren. Und hier ist nun die Buchliteratur der filmischen offenbar doch überlegen. Ich sage das, obwohl mir bewusst ist, dass es eine genaue Entsprechung zu dem eben gesehenen Dialog zwischen Bastian und Herrn Koreander in Michael Endes Vorlage (1979, 6-9) nicht gibt, die Lektürebiografie des Helden in dieser Explizitheit vielmehr eine Zutat des Films ist. Ende hat aber das Motiv ‘Buch im Buch’ bereits benutzt: Was Bastian in seinem selbstverordneten Alternativprogramm zu einem ganz gewöhnlichen Vormittag im Klassenzimmer auf dem schulischen Dachboden ja tut, ist, sich selbst in das Buch hineinzulesen, das er aus dem Antiquariat mitgebracht hat. Und dieses Motiv, ein im Buch auftauchendes Buch, das entweder den nämlichen Buchtitel trägt oder anderweitig eine zentrale Funktion für den Fortgang der Handlung hat, ist ein dem Buch in besonderer Weise entsprechendes medienreflexives Motiv. (Es ist ähnlich medienadäquat wie die Motive Videobrief, Videotagebuch oder Casting, die uns schon begegnet sind, dem Film). In Andreas Steinhöfels Der mechanische Prinz ist das Buch im Buch das gerade eben Erzählte - der Erzähler erfährt die Geschichte in Fortsetzungen von einem erstaunlichen Jungen, den er immer wieder im Stadtparkrestaurant trifft. Die erwähnten Texte von Eoin Colfer, Cornelia Funke, Andreas Steinhöfel u.a. zeigen damit, schon bevor sie in Verfilmung oder Computerspiel adaptiert werden bzw. worden sind, wie medienreflexiv gerade das fantastische Genre heute ist. | |||||||||||
4. Ein neues Kindheitsbild als Gegenstand schulischer Medienrezeption und Herausforderung für den DeutschunterrichtIch versuche ein Resümee und ziehe dann einige didaktische Schlussfolgerungen. Die erwähnten Bücher, Hörbücher und Filme haben eine doppelte Funktion im Prozess der literarisch-medialen Sozialisation: Sie thematisieren die mediale Durchdringung dieses Prozesses in unserer gegenwärtigen Lebenswelt, und sie bieten sich selbst an als geliebte Objekte, deren Beitrag zur symbolic selfcompletion man zwar überschätzen mag, aber doch insgesamt nicht leugnen wird. Denn sie behaupten Kinder als beinahe erschreckend kompetente Leser (Meggie in Funkes Tintenherz) und als definitiv bestürzend kompetente Computerhacker (die jungen Helden von Kletter-Ida, aber auch Colfers Artemis Fowl). Besonders | |||||||||||
[pagina 73]
| |||||||||||
interessant ist Katja und der Falke: Die Eröffungssequenz zeigt dass oft konstruierte Gegensätze zwischen Primär- (z.B. Natur-)Erfahrung und Sekundär- (z.B. Edutainment-)Erfahrung am PC heute nicht mehr tragen; beides geht für Katja selbstverständlich zusammen, und beides hat seinen Grund darin, dass die Eltern sich nicht um das Kind kümmern. Dass es daneben - Rowlings Hermione ist die wohl wirkmächtigste Konkretisation - auch noch das Kindheitsbild des Buch-Lerners und Wissenserwerbers im Medium der Schriftlichkeit gibt, sei der Vollständigkeit halber angemerkt. Das Kindheitsbild, an dem hier gebastelt wird, entsteht in Übertragung dessen, was Norbert Bolz (1993, 118) über Medien im Leben Erwachsener gesagt hat. Sie seien ‘Erweiterungen des Menschen’. Wenn Rainald Merkert (1992, 86) darin Recht hat, dass Kinder heute für den ‘Prozeß des Weltbegreifens und Weltdeutens’ die Deutungsmuster nutzen, die ihnen die Medien zur Verfügung stellen, und wenn man darin auch das Selbstbegreifen und Selbstdeuten einschließt, so heißt das doch: Kinder nehmen sich als mindestens prinzipiell zu solcher Medienbeherrschung fähige Wesen wahr, und sie richten ihren Ehrgeiz auf diese Art der Selbsterweiterung. Das bezieht sich, wohlgemerkt, auf alle Medien einschließlich des Buches. Eine pädagogisch und/oder kulturkritisch motivierte Warnung vor Fernsehen, aktuellem Kino und Computer lässt sich keineswegs daraus ableiten. Ich sage im Übrigen auch nicht, dass die Medien diese Herrschaftssehnsüchte nur auslösen; monokausale Beschreibungen sind ja fast immer falsch. Mindestens im selben Ausmaß wird hier gelten, dass Medien auf das reagieren, was an Gratifikationserwartungen da ist, und es im besten Fall reflektieren - und zwar in einem doppelten Sinn: zurückspiegeln und ästhetisch bearbeiten. Wie sehr das einen Nerv trifft, zeigen enthusiastische Reaktionen auf gelungene mediale Reflexionen dieser Art: Die Kinderjury der Nordischen Filmtage Lübeck verlieh Katja und der Falke ihren Hauptpreis; auf der ‘Cinekid’ in Amsterdam wurde er mit dem Publikumspreis ausgezeichnet, beim Internationalen Filmwochenende in Würzburg als ‘Bester Kinderfilm’ prämiert. Auch auf zwei italienischen Festivals bedachten Jurys die Geschichte der kleinen Dänin, die in Italien ihren Wanderfalken sucht, mit Hauptpreisen. Die Website www.kinoweb.de kommentiert: ‘Kein Wunder: “Lustig, aufregend, spannend - genau wie ein Film für uns sein sollte!”, lobte ein kleiner Filmkritiker auf den Kinderseiten des dänischen Ekstra Bladet. Regisseur Lars Hesselholdt inszenierte liebevoll und originell ein fesselndes Kinder-Abenteuer, in dem Freundschaft ohne Worte auskommt, und die jungen Helden wohltuend ernst | |||||||||||
[pagina 74]
| |||||||||||
genommen werden. Ein ebenso anrührender wie anspruchsvoller Kinderfilm, gedreht an Originalschauplätzen in Dänemark und Italien.’Ga naar voetnoot3. Kein Wort davon, dass es hier auch um eine mediatisierte Lebenswelt gehen könnte; und dieser blinde Fleck in der Rezeption fällt auch in anderen Fällen auf, etwa bei Kletter-Ida. Idas Eltern leben nach dem schweren Unfall von einer Gokart-Bahn und der in der Bank jobbenden Mutter. Das Geld für die OP in der amerikanischen Spezialklinik ist nicht aufzubringen, keine Bank gibt ohne Sicherheiten Kredit. Die Kinder müssen es, um den Bankdirektor umzustimmen, erst stehlen, wodurch der Film optische und logistische Anleihen bei Kriminalund Agentenfilmen nimmt und sich vor allem massiv auf die Medienkompetenz der 12jährigen Robin-HoodFiguren verlässt. Auf der deutschen Website des Films Kletter-Ida (www.kletter-ida.de) heißt es ohne jede Erwähnung der wesentlichen Rolle, die Medienbeherrschung für den Handlungsverlauf spielt, aber lediglich: ‘Ida ist wütend über die Gleichgültigkeit der Bank, die weiterhin jeden Kredit verweigert und verzweifelt genug, um mit ihren Freunden das scheinbar Unmögliche zu wagen: ausgestattet mit einer Profi-Kletterausrüstung, einem Paar geliehenen Gokarts - und dem Mut zweier verliebter Herzen, die Ida von sich überzeugen wollen - begibt sich das Trio auf eine gefährliche Mission: den sichersten Tresorraum der Welt zu knacken und die CCT Bank um satte 1,5 Millionen Dänische Kronen zu erleichtern...’. Der metamediale Diskurs, der - hier ausgeblendet - unauffällig mitläuft, hat durchaus Raffinesse:
| |||||||||||
[pagina 75]
| |||||||||||
Ich komme zum Schluss, d.h. zu einigen Vorschlägen für die Rolle, die Kinderund Jugendmedien wie die hier kommentierten in einem medienreflexiven Unterricht spielen (sollten). Solche Medien bieten nicht nur der Leseförderung neue Möglichkeiten, sondern sie bringen, wenn man es (z.B. durch Schülerreferate, Klassenlektüren, Kinobesuche, Besuche auf offiziellen und Websites für Fans) zulässt, neue, teilweise recht irritierende Vorstellungen von Kindheit und Jugend auch in den Unterricht. ‘My friends all drive Porsches, I must make amends...’. Hieran scheiden sich, pädagogisch und didaktisch gesehen, die Geister: Soll die Theorie und Praxis des Deutschunterrichts die Beschäftigung mit solchen Stoffen, Themen und ‘eingelagerten’ Mediendiskursen forcieren, und mit welchem Ziel? Auf welche Weise? Ich kann eine Antwort nur andeuten. Gerade die - eben angedeuteten - ambivalenten Botschaften, die Filme, Bücher und Hörbücher wie die hier vorgestellten aussenden, empfehlen solche Unterrichtsgegenstände dem interpretierenden Gespräch, der Diskussion, dem Schreiben und der szenischen Gestaltung. Ziel dabei ist die Interpretation, nicht die Bewertung des Verhaltens der Figuren. Man sollte möglichst wertungsabstinent herangehen; zu groß ist sonst die Gefahr, dass unsere Erwachsenenoptik den Schülerinnen und Schülern eine Sichtweise aufzwingt, die ihnen nicht entspricht. Wer über Filme wie Kletter-Ida oder Nach fünf im Urwald, oder über Büchern wie Artemis Fowl, mit Kindern oder Jugendlichen ins (Unterrichts-)Gespräch kommen will, sollte seine Werturteile hinanstellen. Er erfährt sonst vermutlich wenig darüber, die die Lernenden auf die hier inszenierten Rollenentwürfe reagieren: Wie sehen sie solche neuen Kindheits- und Jugendbilder? Wir wissen es nicht; die Bücher und Filme, die wir der nächsten Generation da auf ihren Weg mitgeben, erzählen aber, was wir ahnen. Neben der zutiefst unglücklichen Luise in Pünktchen und Anton stehen Figuren wie Jonas, die die Eltern weg sein lassen sich ihr Leben einfach selber basteln. Wir müssen uns in der Schule der Notwendigkeit stellen, Mediengewohnheiten und die subjektive Lebensbedeutung einzelner Medien zum Thema zu machen - nicht um uns gegenseitig vor den Gefahren zu warnen, sondern um uns selbst und einander überhaupt zu verstehen. Reflexion der Medien im Deutschunterricht setzt Offenheit, Äußerungskompetenz und Gesprächsbereitschaft auf beiden Seiten voraus; aber wenn die Gegenstände richtig gewählt sind, kann er solche Fähigkeit und Bereitschaft auch aufbauen. Dazu brauchen wir Aufgaben: | |||||||||||
[pagina 76]
| |||||||||||
| |||||||||||
Quellen:Kinderroman/Hörbuch
| |||||||||||
Kinder- und Jugendfilm
| |||||||||||
Fachliteratur
| |||||||||||
[pagina 77]
| |||||||||||
|
|

